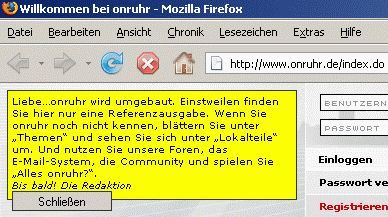„Was meinst du damit, du verlässt Europa?“ Fassungslos gucke ich meinen Onkel Andy an. Andy, ein Engländer, der seit mehreren Jahren in München lebte, ist auf Abschiedsbesuch in Aachen. Er wechselt Job, Stadt, Land und gleich auch noch Staatsangehörigkeit, um auf der Isle of Man zu arbeiten. Der britischen, aber nicht englischen Isle of Man: Die Insel in der irischen See ist nämlich ein ganz besonderes Fleckchen Erde. Das sogar etwas mit Aachen zu tun hat.
Über die nur 572 Quadratkilometer große Insel weiß man hierzulande eigentlich nur, dass dort die Katzen keine Schwänze haben und auf ihren Straßen alljährlich ein ziemlich mörderliches Motorradrennen namens Tourist Trophy stattfindet.
Was allerdings bei weitem nicht alles ist, was das Eiland an Skurrilitäten zu bieten hat. Die Isle of Man, im dortigen Gälisch-Dialekt Ellan Vannin genannt, gehört nämlich weder zur Europäischen Union, noch zu England. Sie ist direkt der britischen Krone unterstellt, und damit auch kein Teil des United Kingdom oder des Commonwealth. Wer dort einreist, verlässt die EU.
Logischerweise legen die von Wikingern abstammenden rund 76.000 Einwohner – gegenüber ihren 170.000 Schafen in beängstigender Unterzahl – auch Wert auf eine eigene Währung. Die ist zwar 1:1 an das britische Pfund gekoppelt, sieht aber anders aus. Immerhin besteht das dortige Pfund heute nicht mehr aus 280 Pence, von denen 14 einen Shilling bilden. Auf dem 20-Pfund-Schein ist das Laxey Wheel abgebildet, das größte Wasserrad der Welt.

Dem längsten Drehstromkabel der Welt, das die Insel mit Elektrizität versorgt, ist dagegen unfairerweise keine Banknote gewidmet.
In der Hauptstadt Douglas, malerisch in eine Bucht geschmiegt, tagt das Tynwald, mit mehr als 1.000 Jahren Tätigkeit das älteste ununterbrochen tätige Parlament der Welt. Es verkündet seine Gesetze auf dem Tynwald-Hügel. Das Staatsoberhaupt ist der Lord of Mann und derzeit eine Frau, nämlich Königin Elisabeth II.
Während man auf den rund 500 Kilometer Inselstraßen mangels Tempolimit meist unbeschwert rasen darf, geht es auf den Eisenbahnen geruhsamer zu. Es gibt gleich fünf verschiedene Bahnsysteme: Von Dampf-, Elektro- oder Pferdekraft angetrieben, bewegen sich die Züge auf verschiedenen Spurweiten über die Gleise.
Womit wir bei der Beziehung zu Aachen wären, denn die beschränkt sich nicht auf das rituelle Streuselbrötchen, das Andy zum Frühstück vorgesetzt bekam. Als nämlich Anfang der Siebziger Jahre die ASEAG ihr Straßenbahnnetz auflöste, verkaufte sie die Fahrzeuge in aller Herren Länder (was eine weitaus bessere Verwertungsmethode war, als sie, wie 1944 geschehen, als fahrende Bomben auf feindliche Truppen rollen zu lassen). So erwarb auch die Isle of Man Transport Motoren und Fahrzeugtechnik aus Aachen.
Das hierzulande erstandene Material bauten die sparsamen Insulaner in ihre vorhandenen, bereits damals rund 70 Jahre alten Wagen ein. Spätestens daraus wird deutlich, dass die Insel genauso nah an Schottland wie an England liegt.

Heute sind die hundertjährigen Manx-Triebwagen die ältesten noch fahrenden Straßenbahnen der Welt. Wer mit ihnen auf den 621 Meter hohen Snaefell-Berg fährt, verdankt es auch Technik aus Aachen.
Komischer Ort, diese Isle of Man. Gestern wusste ich praktisch nichts von ihr. Heute will ich unbedingt mal hin.